Wer oder was ist der Heilige Geist?
Predigt zu Pfingsten vom 19. Mai 2024: Pastor Frank Moritz-Jauk
Liebe Gemeinde, heute ist tatsächlich Pfingsten. Und manche der heute hier Anwesenden wissen auch tatsächlich was wir an Pfingsten feiern.
Ich sage dieses „manche der Anwesenden“ ganz bewusst, denn ich finde, man soll vorsichtig mit dem „wir“ sein. Und dieses „manche“ können ja 99 Prozent sein. Aber vielleicht weiß es eine Person die heute hier ist nicht. Dann kann man nicht von „wir“ reden. Sondern sollte noch einmal ansprechen, worum es geht.
An Pfingsten feiern wir die Gabe oder das Kommen des Heiligen Geistes. Alle Lesungen und die meisten Lieder, die wir bis zum jetzigen Zeitpunkt gehört und gesungen haben, beschäftigen sich mit dieser Erscheinungsform Gottes: Dem Heiligen Geist.
Und wer genau zugehört hat oder sich die Texte der Lieder noch einmal in Erinnerung ruft wird merken: Der Heilige Geist - also zu sagen wer oder was das wirklich ist - das ist gar nicht so einfach!
Daher möchte ich diese Frage zum zentralen Anliegen dieser Predigt machen: Wer oder was ist denn der Heilige Geist? Wie können wir ihn uns vorstellen? Was können wir von ihm erwarten? Welche Bedeutung hat der Heilige Geist für uns in unserem ganz alltäglichen Leben?
Und in einem zweiten Schritt möchte ich fragen, warum der Heilige Geist bei uns evangelischen oder evangelisch interessierten Christinnen und Christen so eine unterbelichtete Rolle spielt. Ich habe dieser Predigt sozusagen einen Untertitel gegeben und der lautet: Die Furcht der Evangelischen: Der Heilige Geist als Kontrollverlust - Fragezeichen? Doch dazu später.
Beginnen möchte ich mit der Frage: Wer oder was ist der Heilige Geist?
Mit dieser Fragestellung wird eine erste Schwierigkeit im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist sichtbar: Handelt es sich jetzt um ein „wer“ oder um ein „was“? Geht es um eine Person oder um eine Kraft?
Die heutigen Lesungen legen nahe, dass es sich um eine Person handelt. Im Römerbrief tritt der Geist Gottes mit Flehen und Seufzen für uns ein. Das legt nahe, dass es sich um ein Gegenüber handelt. Und nicht einfach nur um eine Kraft.
Auch der Text aus dem Johannesevangelium spricht eher von einer Person, wenn der Heilige Geist als Helfer vorgestellt oder benannt wird.
Gleichzeitig gibt es Stellen in der Bibel, wo von der Gabe des Heiligen Geistes die Rede ist. Ebenfalls im Johannesevangelium empfangen die Jüngerinnen und Jünger den Heiligen Geist von Jesus. Wörtlich heißt es: „Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist.“
Oder in der Apostelgeschichte kommt der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf die Menschen. Worauf sie beginnen in verschiedenen Sprachen zu sprechen.
Diese beiden Stellen widersprechen der Vorstellung einer Person. Eine Person kann man ja nicht hauchen. Oder eine Person bleibt ja eine Person und kann sich nicht aufteilen, um gleichzeitig auf alle Jüngerinnen und Jünger zu kommen.
Was ist jetzt richtig? Was ist die Wahrheit?
So sehr ich diese Anfragen verstehe, weil ich früher auch so gefragt habe, so sehr muss ich heute sagen, dass uns diese Fragen nicht weiter bringen.
Es ist zwar richtig, dass es keine falschen Fragen gibt. Aber ebenso richtig ist, dass es auf manche Fragen keine Antworten gibt. Oder dass es auf manche Fragen keine eindeutigen, eindimensionalen Antworten gibt.
So wie ich die Bibel heute verstehe, geht es selten um ein „entweder - oder“
Also nicht um die Frage ist es jetzt so oder so. Entweder ist das richtig, dann muss das andere falsch sein oder das andere ist richtig, dann muss das erste falsch sein.
Eine der Hauptaufgaben der Bibel, ist, uns die Wirklichkeit Gottes näher zu bringen. Uns durch die verschiedenen Geschichten und Beschreibungen eine Ahnung davon zu geben, wer und wie Gott ist.
Dass diese Annäherung an den Schöpfer des Universums aber eben immer das ist und bleiben wird - eine Annäherung - liegt für mich auf der Hand.
Als Mensch ist es mir nicht gegeben Gott umfassend zu verstehen. Die Folge dessen ist, dass ich als Mensch nie in der Lage sein werde, Gott umfassend zu beschreiben. Und so geht es auch den verschiedenen Verfassern der biblischen Schriften. Alle waren sie Menschen und alle beschreiben sie, was sie erlebt oder erfahren haben.
Das bedeutet, ich kann mir den Heiligen Geist einmal als Person und ein andermal als Kraft vorstellen. Gleichzeitig oder nacheinander spielt dabei keine Rolle.
Entscheidend ist, was wir vom Heiligen Geist erwarten dürfen. Und wo wir ihn in unserem Alltag erleben und erfahren können.
Für mich ist das Zeugnis von Gottes Wirklichkeit eine ganz zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes. Im heutigen Text sagt Jesus: Er, der Heilige Geist, wird meine Herrlichkeit offenbaren.
Zeitgemäßer ausgedrückt heißt das: Der Heilige Geist wird sichtbar oder erfahrbar machen, dass Jesus der Sohn Gottes und damit Gott selbst ist.
Diese Wirklichkeit, diese Bedeutung von Jesus, war den Jüngerinnen und Jüngern zu Jesu Lebzeiten verschlossen. Alle Aussagen von Jesus die in diese Richtung gehen, stossen bei ihnen auf Unverständnis. Und Hand aufs Herz: Ich kann es ihnen nicht verdenken. Ein Mensch aus Fleisch und Blut steht vor dir und sagt er ist der Sohn des himmlischen Vaters?
Das ist eine Schwierigkeit, die wir heute nicht mehr haben. Und gleichzeitig bleibt es ein Wunder oder ein Geschenk oder eben ein Wirken des Heiligen Geistes, dass wir glauben können. Glauben, dass dieser Jesus auferstanden ist und wir und die Welt durch ihn gerettet sind.
Eine weitere, ganz praktische Auswirkung des Heiligen Geistes oder der Geistkraft ist die Erfahrung der Nähe Gottes. Sei das, dass wir merken, dass da jemand unsere Gebete hört. Oder sei das, dass wir gute Worte der Ermutigung und des Trostes für unsere Mitmenschen finden. Oder sei das, dass wir angesichts so mancher Katastrophe nicht verzweifeln.
Gerade der letzte Punkt, dass wir angesichts der Lage der Welt nicht verzweifeln, weil wir eine Hoffnung kennen, die über den Tod hinaus reicht, wäre heutiges Evangelium. Frohe Botschaft.
Die frohe Botschaft ist, dass Gott diese Welt in seinen Händen hält. Oder wie wir es heute gehört haben, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben.
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass der Heilige Geist die entscheidende Ursache unseres Glaubens ist. Alles was wir heute und in unserem Alltag als Gottes Nähe erleben, ist die Auswirkung dieses Heiligen Geistes. Ob wir ihn jetzt als Person oder als Kraft erleben ist dabei situationsabhängig. Es kann und darf beide Vorstellungen geben.
Die Furcht der Evangelischen:
Der Heilige Geist als Kontrollverlust - Fragezeichen?
Ich möchte euch diese Frage zum weiteren Nachdenken oder zur Diskussion beim Kirchenkaffee mitgeben. Denn wenn wir den Heiligen Geist zum Thema haben müssten wir doch auch die Gaben dieses Heiligen Geistes ansprechen, so wie sie beispielsweise im 1. Korintherbrief beschrieben werden:
Die Gabe Kranke zu heilen, Wunder zu tun, prophetisch oder in anderen Sprachen zu reden oder diese auszulegen.
Für die zahlenmäßig meisten Christinnen und Christen dieser Erde ist das ein großes Thema. Für mich und für unsere Gemeinde oder die EmK Österreich ist es ein ausgesparter Bereich. Woran liegt das? Ist das gut oder schlecht?
Bei einem ersten Nachdenken habe ich einmal für mich aufgeschrieben, was denn das entscheidende Stichwort ist, das ich mit den verschiedenen Konfessionen in Verbindung bringe. Was ich als Zentrum beschreiben würde.
Charismatische Gemeinden - der Heilige Geist.
Orthodoxe Kirchen - die heilige Liturgie.
Für unsere römisch - katholischen Geschwister - die Kirche als Institution.
Und wir Evangelischen - das Wort.
Ich glaube tatsächlich, dass das Wort, also das Lesen und verstehen wollen der Bibel, bei evangelischen Christinnen und Christen einen hohen Stellenwert hat. Man will verstehen. Auch wenn man am Ende, so wie auch heute, einsehen muss, dass nicht alles zu verstehen ist.
Dieser vom Verstand ausgehende Zugang steht uns evangelischen Christen vielleicht tatsächlich im Weg, die Möglichkeiten des Heiligen Geistes in einer tieferen Dimension zu erfahren.
Vielleicht ist das aber auch nur meine persönliche Geschichte oder mein persönlicher Zugang. Vielleicht habt ihr auf Grund eurer Traditionen und eurer Herkunft ganz andere Erfahrungen gemacht.
In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Und so die Erfahrung von Pfingsten miteinander teilen können.
Amen.
Judas Ischariot – Einladung zum „Querdenken“
Predigt vom 12. Mai 2024: Predigthelferin Karin Erhard
Liebe Gemeinde, wir sind eine bunte Gemeinde mit mehreren Nationalitäten und vielen verschiedenen Namen. Namen haben ihre Bedeutung und ihre Assoziation und oft kann man aufgrund des Vornamens oder Familiennamens Personen Ländern und Nationalitäten zuordnen.
2023 waren die beliebtesten Vornamen in Österreich Emilia (Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "die Eifrige" oder "die Fleißige") und Leon (Altgriechisch für "der Löwe", "der Starke")
Es gibt aber auch Namen, die man in Österreich seinem Kind nicht geben darf: z. B. Pumuckl, Medusa, Pepsi oder Nutella, Sputnik, Tiger
Und es gibt einen Fall, wo man sogar den Vornamen Rainer seinem Kind nicht geben darf. Dies ist dann, wenn der Familienname „Zufall” lautet.
Und einen Namen unseres Bibeltextes werden wir in Österreich wahrscheinlich auch nicht genehmigt bekommen und das ist Judas, da der Name mit dem Begriff „Treulosigkeit und gemeinem Verrat“ assoziiert wird und in Österreich darf der Name dem Kind keinen Schaden bringen.
Auch wenn im Predigttext viel Wertvolles der Abschiedsreden Jesu vorkommt, habe ich mich entschieden, über Judas Iskariot zu predigen, welcher in den gehörten Texten der Lesungen beides Mal kurz bzw. im Zusammenhang vorkommt.
Zu Jesu Zeiten war Judas ein weit verbreiteter männlicher Vorname. Unter den zwölf Aposteln gab es noch einen zweiten Jünger dieses Namens, Judas Thaddäus. Auch ein leiblicher Bruder Jesu hieß Judas.
Nun zum Thema Verrat:
Verrat gilt landläufig als eines der schlimmsten Vergehen überhaupt oder, um es neudeutsch zu formulieren, als moralisches No-Go. Es hat mit dem Missbrauch von Vertrauen zu tun und stellt einen eklatanten Loyalitätsbruch dar.
Allerdings ist die Sache längst nicht immer so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
Z. B. war der gescheiterte Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg davon überzeugt, dass er als gemeiner Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Heute jedoch wird er oft als ein Vorbild an Zivilcourage gefeiert.
Und ähnlich ist es mit Edward Snowden. Es stellt sich auch bei ihm die Frage: Hat der ehemalige NSA-Mitarbeiter Landesverrat begangen oder hat er nicht vielmehr der ganzen Welt einen großen Dienst erwiesen, indem er die Überwachungspraktiken der Geheimdienste publik machte? Da mag das Urteil je nach unserer ganz persönlichen Wahrnehmung sehr unterschiedlich ausfallen.
Bei Judas sind oder waren sich die meisten einig. Für 30 Silberlinge verriet er Jesus. 30 Silberlinge waren wahrscheinlich zwei- bis dreitausend Euro und man konnte sich damit z. B. einen kleinen Acker oder einen Esel kaufen.
Bei genauem Hinsehen weist die Geschichte, die die Evangelien von ihm erzählen jedoch einige Ungereimtheiten auf. Zum Beispiel folgende:
Sollte Judas wirklich allein aus purer Habgier seinen Verrat begangen haben? Er hatte, wie wir wissen, innerhalb der Jüngerschar die Verantwortung für die Kassa. Mit einer solchen Aufgabe wird aber normalerweise nur jemand betraut, der als besonders vertrauenswürdig gilt. Falls es Judas nur ums Geld gegangen wäre – hätte er dann nicht einfach mit der Kassa durchbrennen können?
Noch ein weiterer Umstand bringt mich zum Nachdenken: Wieso bedurfte es im Garten Gethsemane eines Kusses, um den anderen zu zeigen, wer Jesus ist? Die Hohenpriester und Hauptleute des Tempels waren doch dabei. Sie hätten Jesus von seinen täglichen Auftritten im Tempel zweifellos auch ohne den Kuss erkannt.
In dem Musical Jesus Christ Superstar wird übrigens eine ganz eigene Version der Verratsgeschichte präsentiert. Dort ist es so, dass Judas deshalb zum Verräter wird, weil Jesus im Kontext von Liebesliedern der Maria Magdalena den Freiheitskampf gegen die Römer vernachlässigt.
Möglicherweise ist es tatsächlich so gewesen, dass sich im Laufe der Zeit in Judas eine gewisse Unzufriedenheit mit Jesus aufgestaut hat. Vielleicht hat Judas sich gedacht: „Wenn ich Jesus in eine Lage bringe, in der er gezwungen ist, endlich zu handeln, dann wird der Umsturz gelingen. Falls Jesus wirklich der Messias ist, braucht er möglicherweise nur einen kräftigen Stoß und dann endlich befreit er uns von den Römern.“ Diese Interpretation wird zusätzlich gestützt durch den Beinamen des Judas: Iskariot. Das könnte ein Indiz dafür sei, dass Judas zu den sogenannten Sikariern gehörte. Die Sikarier waren, ähnlich wie die Zeloten, eine militante antirömische Gruppierung.
In der Predigtvorbereitung habe ich mir auch den Film „Judas“ von Enrico lo Verso angesehen, dort finden wir eine etwas ähnliche Geschichte. Judas ist in diesem Film der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns und er ist schwer überzeugt, dass Jesus der Messias sei und versucht auch immer wieder, andere davon zu überzeugen. Im Film nimmt Judas sich nach dem Verrat nicht sofort das Leben, sondern er ist er sogar einer der wenigen, die später vor Pilatus nicht „Barabbas“, sondern „Jesus“ schreien. Sein sogenannter Verrat ist im Film eigentlich eine Provokation Jesu, damit Jesus als Messias endlich anfängt, gegen die Römer vorzugehen, wie Judas es sich vorstellt.
Als Jesus vor Pilatus steht, gibt es im Film eine Szene, wo Petrus in der Menge zu Judas geht und diesem gesteht, dass auch er aus Angst Jesus verraten bzw. verleugnet hat. Judas tröstet Petrus und sagt ihm „Feigheit ist nicht weiter schlimm“ und „Bitte Jesus einfach um Vergebung.“ Judas beobachtet dann aus der Ferne die Kreuzigung und hofft bis zum letzten Atemzug auf das Einschreiten Jesu bzw. seinen imposante Machtbeweis als Messias. Erst mit dem Tod Jesu bricht im Film für Judas die Welt zusammen und er läuft davon, um sich das Leben zu nehmen. Petrus läuft ihm im Film hinterher, aber er kann den Tod nicht verhindern.
Wie wir sehen, haben sich bisher viele über Judas den Kopf zerbrochen. Und auch in den Evangelien ist das Bild, das wir von Judas gezeichnet bekommen, sehr unterschiedlich. Allerdings bleiben uns die eigentlichen Motive von Judas verborgen.
Im Johannesevangelium kommt Judas wahrscheinlich am schlechtesten weg. Doch warum? Johannes nennt sich selbst im Johannesevangelium „der Jünger, den Jesus liebte“. Er beschreibt eine innige Beziehung zwischen sich und Jesus. Für alle Jünger war der Tod Jesu ein Schock, vielleicht für den Johannes ganz besonders. Vielleicht fiel es ihm auch sehr schwer, dem Judas zu vergeben, vielleicht hat er deshalb auch Judas in die Schublade gesteckt: „Der war immer schon ein Dieb“. Aber eigentlich steht noch viel Schlimmeres über Judas im Johannesevangelium: Schon im Kapitel 6 schreibt Johannes, dass Jesus wusste, wer ihn verraten würde und dass einer von den Jüngern ein Teufel sei.
Und obwohl beim letzten Abendmahl Jesus auch dem Judas die Füße wäscht, heißt es etwas später im Kapitel 17, Vers 12 (wie wir es bei der Lesung gehört haben) (Jesus:) „Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt.“
Und jedes Mal, wenn ich das lese oder höre, zucke ich zusammen. Mich schockiert die Härte der Worte und ich frag mich, ob das wirklich die Worte Jesu sein können. Jesus, der mit den Sündern gegessen hat, sich von ihnen berühren hat lassen, wertschätzend gegenüber Kindern, Frauen und Fremden war, soll einen Menschen benutzt haben, damit sich die Schrift erfüllt? Und dann hat er ihn verdammt… Wie passt das zusammen mit dem, was wir sonst über Jesus hören?
Alle Jünger sind bei der Gefangennahme Jesu aus Angst davongelaufen, Petrus hat Jesus verleugnet und dennoch bezeichnen viele die elf Apostel als „Heilige“.
Wir nennen die Bibel oft unsere Richtschnur. Das heißt aber nicht, dass die Bibel in Bezug auf jedes Wort wörtlich zu nehmen ist. In der Bibel begegnen wir eigentlich einer ganzen Sammlung von verschiedenen Büchern und verschiedenen Genres. 66 Bücher sind es – 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament – manche sind z. B. Geschichtsbücher, Lieder und manche sind Gedichte, die ihre Poesie haben, aber absurd wären, wenn es um die Wahrheit von jedem Wort ginge.
Und was ich erst in den letzten Jahren gelernt und akzeptiert habe, ist, dass gerade manch subjektive Note eines Verfassers nicht den Wert der Bibel in Frage stellt, sondern sogar eine Hilfe sein kann und ist, weil wir auf besondere Art und Weise sehen dürfen, was den Verfasser bewegt hat, womit er gekämpft hat, aber auch, was ihn und seine Sichtweisen geprägt hat.
Ich fasse zusammen:
Filme und Geschichten über Judas beschäftigen sich nicht nur mit Judas alleine. Sie beschäftigen sich im ganz besonderen Maße mit Jesus, seiner Glaubwürdigkeit und auch mit unserem Gottesbild.
Somit ist wichtig, Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wer ist Gott für uns?
Für unser Herz ist es oft eine lebenslange Reise, voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Wir gehen durch Krisen und Zweifel. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes immerwährende Liebe vor Augen haben, eine Liebe, die uns nie fallen lässt, nie abschreibt und nie verdammt, sondern die uns immer erreichen wird, wie es im Psalm 139 so schön poetisch heißt: „Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag.“
Auf dem Gottesdienstblatt habe ich euch daher ein paar Zeilen von Hans-Joachim Eckstein geschrieben, die ich nun als Abschluss vorlese:
Glaube kennt keine Beschränkung.
Hoffnung kennt keine Zeit.
Liebe kennt keine Grenzen.
Amen.
Wir, die Nichtjüdinnen und Nichtjuden
Predigt vom 05. Mai 2024: Pastor Frank Moritz-Jauk zu Apostelgeschichte 10, 44-48
Liebe Gemeinde, in zwei Wochen ist Pfingsten. Nächsten Sonntag noch Muttertag, dann aber Pfingsten. Und mit Pfingsten werden traditionell zwei große Themen angesprochen: Die Gabe des Heiligen Geistes und die Geburtsstunde der Kirche.
Unser heute gehörter Text ist zeitlich gesehen deutlich hinter dem berühmten Pfingstwunder anzusiedeln. Also diesem Brausen vom Himmel und den Feuerzungen, wie es in der Apostelgeschichte im Kapitel zwei beschreiben wird.
Dennoch – und das ist wichtig – wird hier das gleiche Zeichen oder der gleiche Beweis angeführt, dass es sich wirklich um die Gabe des Heiligen Geistes handelt. Die Versammelten begannen nämlich in geistgewirkten Sprachen zu reden. Und weil das so war, wurden sie auch getauft. Also mit der Taufe zu vollwertigen Mitgliedern der neuen Gemeinschaft von Christinnen und Christen. Auch Kirche genannt.
Ich möchte heute drei Themen ansprechen, die ich im heutigen Text angelegt sehe. Und das sind erstens die Öffnung der neuen Gemeinschaft in Richtung Nichtjüdinnen und Nichtjuden. Zweitens die Gabe des Heiligen Geistes. Und drittens die Dankbarkeit, dass auch wir heutigen Nichtjüdinnen und Nichtjuden, sprich du und ich, zu Gott gehören dürfen.
Öffnung
Wenn wir mit dem ersten Thema beginnen, der Öffnung der neuen Gemeinschaft in Richtung Nichtjüdinnen und Nichtjuden, dann ist es wichtig festzuhalten, dass unser heutiger Text der Endpunkt einer groß angelegten Erzählung ist.
Sie beginnt mit der Vision eines römischen Hauptmanns mit Namen Kornelius aus Cäsarea. Diesem erscheint ein Engel Gottes, der ihn auffordert Petrus zu sich einzuladen. Dieser Petrus, gemeint ist natürlich der Apostel Petrus, verweilt gerade in Joppe. Wie Cäsarea eine kleine Hafenstadt, ca. 40 km von Cäsarea entfernt. Und dieser Petrus hat einen Tag später auch eine Vision. Er sieht ein riesiges Tuch in dem sich allerlei Tiere befinden, die nach jüdischem Recht als unrein galten; die ein frommer Jude also nicht essen durfte. Und in dieser Vision des Petrus hört Petrus eine Stimme, die ihn auffordert: „Auf, Petrus, schlachte und iss!“ Petrus weigert sich: „Ich habe noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen.“ Darauf wiederholt die Stimme die Aufforderung: „Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein.“ Jedenfalls kommt Petrus zu Kornelius, betritt dessen Haus, was einem frommen Juden eigentlich auch nicht erlaubt war, und beginnt das Evangelium zu verkünden.
Und hier setzt jetzt unser heutiger Text fort. Es ist also ein großer Bogen mit vielen Vorbereitungen und Visionen, der jetzt mit der Gabe des Heiligen Geistes seinen Schlusspunkt findet. Das passiert nicht einfach irgendwie oder beiläufig. Dem Verfasser der Apostelgeschichte, dem Evangelisten Lukas, und ich denke hier können wir auch sagen Gott, war es wichtig, dass dieser bedeutsame Schritt gut vorbereitet ist. Dass der Gott Israels, sich durch die Gabe des Heiligen Geistes, auch Nichtjüdinnen und Nichtjuden zu erkennen oder zu erfahren gibt, ist ja nicht selbstverständlich.
Besonders wenn wir bedenken, dass Jesus selbst diese Öffnung zu Lebzeiten abgelehnt hat. In der Geschichte mit der kanaanäischen Frau sagt Jesus: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt.“ (Matthäus 15,24)
Unser heutiger Text ist also ein Meilenstein auf dem Weg unserer eigenen Heilsgeschichte. Der Gott Israels gibt sich auch Nichtjüdinnen und Nichtjuden zu erkennen. Die Vergebung der Sünden erfahren alle, die an Jesus Christus glauben. Auf den Namen Jesus wurden die Menschen rund um Kornelius und wir selbst getauft.

Leichtigkeit
Den zweiten Punkt, den ich heute ansprechen möchte ist die besondere Form der Gabe des Heiligen Geistes, von der in unserem heutigen Text berichtet wird. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber es heißt: „Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten.“
Da wird niemand gefragt. Es geschieht einfach. Ohne eigene Willensentscheidung und ohne Vorbedingungen.
Ich finde das deshalb so bemerkenswert, weil weltweit gesehen die zahlenmäßig größten christlichen Gruppierungen bis hin zu Kirchen hier eine ganz strenge Reihenfolge festgelegt haben.
Erst musst du deine Sünden bekennen. Dann die Vergebung erfahren. Möglichst noch solltest du genau wissen an welchem Tag und zu welcher Stunde das war.
Vor allem aber musst du es wollen. Du musst dich zu Jesus bekehren. Das muss dein Wille sein. So wie es eben dann auch der Wille all derjenigen ist, die sich nicht zu Jesus bekehren. Und die deshalb verloren gehen werden.
Von all dieser Strenge ist heute überhaupt nicht die Rede. Der Heilige Geist kommt. Ungefragt und mühelos. Auf alle.
Diese Leichtigkeit finde ich wirklich beeindruckend. Wieder einmal wird sichtbar, wie vielfältig die Wege Gottes sein können. Für mich leuchtet hier Gottes Größe und Schönheit auf. Zu ihm möchte ich gerne gehören und sein Kind sein.

Dankbarkeit
Damit komme ich zum dritten Punkt und das ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, dass ich als Nichtjude dazu gehören darf. Dass sich der Gott Israels gegenüber mir geöffnet hat und ich an seinen jüdisch aufgewachsenen Sohn glauben kann. Weil sein Heiliger Geist auch in mir am Werk ist und mir Gottes Wirklichkeit bezeugt hat.
Also so empfinde ich das.
Und ich kann die Verwunderung, die heute so schön beschrieben wurde sehr gut nachvollziehen, wenn es heißt: „Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Cäsarea begleitet hatten – und die übrigens auch das Haus eines Nichtjuden betreten hatten – waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde.“
„Waren außer sich vor Verwunderung“ – man kann hier auch ein gewisses Entsetzen oder eine starke Verunsicherung hören: Ist das nicht unser Gott?
Der Gott Israels? Abrahams, Isaaks und Jakobs?
Ich weiß nicht, wer den Begriff der „feindlichen Übernahme“ kennt. Eine feindliche Übernahme liegt vor, wenn ein Unternehmen versucht, ein anderes gegen den Willen der Unternehmensführung zu übernehmen. Ein Unternehmen kann eine "feindliche Übernahme" erreichen, indem es sich zum Beispiel direkt an die Aktionäre wendet oder um die Ablösung der Unternehmensführung kämpft.
Lange Jahre, und ich fürchte bis hinein in unsere Gegenwart, haben sich Christinnen und Christen eher in einer solchen Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden benommen.
Denken wir an die Darstellung der Synagoge als alte Frau mit gebrochenem Stab neben einer strahlenden jungen Frau mit erhobenem Kreuz. Oder an die Versuche von christlichen Gruppierungen, Jüdinnen und Juden zum christlichen Glauben zu bekehren. Oder wie unsensibel und ich würde es fast schon schamlos nennen, Aussagen des Ersten Testaments auf Jesus bezogen werden.
Ich denke mir dann oft, wie würde es denn mir gehen? Wenn jemand kommt, die Bibel aufschlägt und mir dann erklärt, wie dieser oder jener Text zu verstehen ist. Oder Teile aus der Bibel entnimmt, einen neuen Text daraus formt und diesen für den jetzt gültigen Text erklärt.
Wie gesagt, ich kann dieses „außer sich vor Verwunderung“ auf diesem Hintergrund sehr gut nachvollziehen. Und ich denke, dass wir als Christinnen und Christen hier viel gut zu machen haben in unserer Haltung dem Judentum gegenüber.
Ein ganz bezeichnender Satz, den wir im Christlich-jüdischen Dialog immer wieder anführen, stammt aus dem Römerbrief: „Doch das ist kein Grund verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen (gemeint ist Israel). Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.“ (Römer 11,18)
Und daher bleibe ich persönlich bei meiner Haltung der Dankbarkeit. Danke, dass wir Christinnen und Christen, wir Nichtjüdinnen und Nichtjuden, dazu gehören dürfen.
Amen.
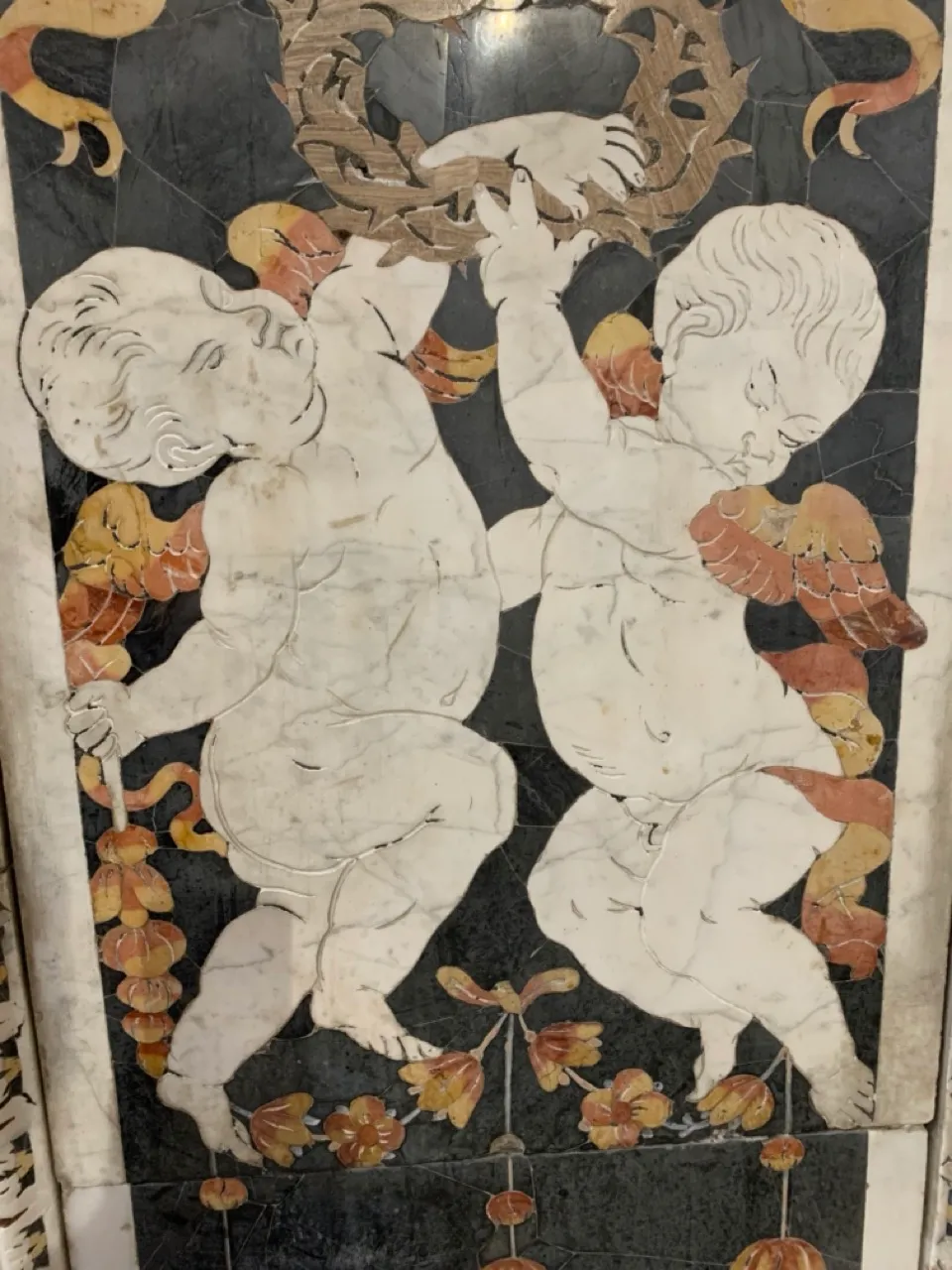
Menschliche vs göttliche Möglichkeiten
Predigt zu Ostern vom 31. März 2024: Predigthelferin Ute Frühwirth zu Markus 16, 1-8
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“
Das waren sicher nicht die Gedanken der Frauen, die an diesem Morgen zum Grab kamen, um Jesu Leichnam mit wohlriechenden Ölen und Salben einzucremen. Ganz im Gegenteil. Was die Frauen in den frühen Morgenstunden erlebten, ließ sie vor Furcht und Entsetzen erzittern. Sie hatten solche Angst, dass sie davon liefen und niemandem davon erzählten. Verständlich, oder?
Wenn ich ein Buch lese, das mich richtig fesselt, dann beginne ich mit den Hauptakteuren des Buches mitzuleben. Da kann es schon passieren, dass mit während des Lesens eine Träne über die Wange kullert, oder mir ein richtig lauter Lacher auskommt. Für mich bedeuten diese Emotionen dann, dass der Autor des Buches seine Sache gut gemacht hat. Wie ist es mit unserer heutigen Geschichte? Welche Emotionen fördert sie bei uns zu Tage?
Wir haben hier drei Frauen: Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome. Diese drei Frauen bereiten sich darauf vor, ihren geliebten Jesus die letzte Ehre zu erweisen, indem sie ihn mit wertvollen Ölen und Salben einbalsamieren wollen. Zwei Tage zuvor mussten sie miterleben, wie er am Kreuz gestorben ist. Sie mussten zusehen, wie er vom Kreuz abgenommen wurde und in ein fremdes Grab gelegt wurde. Sie mussten einen Tag warten, bis sie noch einmal Abschied nehmen konnten, denn sie mussten den Sabbat verstreichen lassen. Jetzt können sie Jesus endlich das letzte Mal sehen. Es ist ihr Ausdruck der Liebe und der Achtung für ihn.
Liebe und Achtung – zwei extrem starke, positive Emotionen. Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, zieht es einem schon den Boden unter den Füßen weg. Hilflosigkeit und Trauer überwältigen einen. Das Leben steht für einige Zeit still. Der Tod ist endgültig. Und nun stellt euch vor: bei der Beerdigung kommt der Bestatter und sagt: „Der Sarg ist leer! Der Verstorbene ist nicht mehr da!“ Der Bestatter müsste sich für diesen geschmacklosen und üblen Scherz sicher einen neuen Job suchen.
Aber genauso erging es den Frauen und später auch den Jüngern. Nur dass der Bestatter in unserer Geschichte ein junger Mann in einem weißen Gewand ist, der den Frauen sagt: „Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden! Er ist nicht hier!“ Dann bekommen die Frauen noch einen Auftrag, nämlich: „Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat.“ Und was machen die Frauen? Sie rennen schreiend davon! Das ist jetzt meine Interpretation. Denn ich würde es tun.
Der ganze Abschnitt dieses Osterevangeliums ist zunächst ein Ausdruck des Unglaubens der Frauen und auch der Jünger. Obwohl der Engel sagt: „Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es angekündigt hat.“ Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt. Seinen Tod glaubten die Menschen damals noch, aber an seine Auferstehung nicht. Pah, Auferstehung! Tot ist tot! Obwohl sie zu Lebzeiten von Jesus schon erfahren und selbst miterlebt haben, dass Jesus die Macht hat, Tote wieder ins Leben zu rufen, können sie nicht begreifen, dass es passiert ist. Jesus ist auferstanden. Er liegt nicht mehr in diesem aus Stein gehauenen Grab mit diesem großen Felsen vor dem Eingang.
Und sie haben mit ihrem Unglauben recht! Aber nur unter einer Bedingung.
Nämlich, wenn wir nur von unseren menschlichen Möglichkeiten ausgehen, von dem, was wir an Erfahrung kennen, dann ist der Unglaube die einzig logische Konsequenz. Uns Menschen fällt es unglaublich schwer, an Dinge zu glauben, mit denen wir keine Erfahrungen gemacht haben.
Ein Beispiel: Stellt euch einmal vor, man hätte den Menschen im Mittelalter gesagt: „In 500 Jahren wird es Maschinen geben, die sind schneller als Pferde. Und mit anderen Maschinen kann man sogar fliegen!“ Man wäre als Hexer oder Hexe verbrannt worden. Oder man hätte Menschen vor 200 Jahren erzählt, dass man mit Hilfe eines Gerätes Bilder und Texte durch die ganze Welt schicken kann. Und wenn man in dieses Gerät hinein spricht, kann man sogar mit jemandem in Amerika sprechen! Die Menschen damals hätten das alles abgelehnt, weil es von ihren damaligen Möglichkeiten einfach nicht denkbar war. Heute kann es jedes Kind.
Und mein Verständnis sagt mir: genauso verhält es sich mit der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu, unsere eigene Auferstehung oder auch die anderen Verheißungen Jesu sind für uns - von unseren Möglichkeiten her – unmöglich.
Und das ist der springende Punkt. Wir gehen zu oft von unseren Möglichkeiten aus. Gehen wir doch von Gottes Möglichkeiten aus, dann ist es kinderleicht! Ein Kamel geht durchs Nadelöhr? Unmöglich! Nicht bei Gott! Wer zweifelt oder nicht glaubt, der geht von den menschlichen Möglichkeiten aus. Und er muss in weiterer Folge bei Karfreitag stehen bleiben. Wer glaubt, der geht von Gottes Möglichkeiten aus. Wer glaubt, der geht von dem aus, was Jesus Christus kann.
Zwei Fragen möchte ich euch stellen:
- Glaubst du daran, dass Jesus Christus ganz andere Möglichkeiten hat als wir? Weil dann kann er Wunder tun, weil dann kann er den Tod besiegen, dann kann er uns unsere Ängste nehmen, dann kann er Krankheit heilen, dann kann er Vergebung und neues Leben schenken.
- Glaubst du, dass der allmächtige und liebende Gott dich im Blick hat? Dass er, mit den Verheißungen, die in der Bibel stehen, dich meint? Dass diese Verheißungen dir gelten? Und dass er das alles in deinem Leben umsetzten kann und will? Glaubst du das? Dann sind wir nicht mehr begrenzt durch unsere eigenen Möglichkeiten. Es öffnet sich für uns ein neuer Horizont des Glaubens.
Denken wir mal an die Zukunft oder auch ganz einfach an die Gegenwart. Es gibt kaum ein Leben, dass immer in geordneten Bahnen abläuft. Aus unterschiedlichen Gründen kann es auf einmal zur Achterbahn werden. Da spreche ich im Moment wirklich grad aus eigener Erfahrung. Wir bekommen es mit der Angst zu tun, wissen nicht, wie uns geschieht und auf einmal steht unser Leben Kopf! Müssen wir mit dieser Angst und Ungewissheit leben, wenn wir wissen, was Jesus Christus kann? Wenn wir von seiner Liebe zu uns und seinem Blick auf uns wissen?
Gott hat mit der Auferstehung Jesu alles bestätigt, was Jesus gesagt und getan hat. Mit der Auferstehung hat er gezeigt, dass wir mit ihm rechnen können. Gehen wir mal die Bereiche unseres Lebens durch und fragen uns: wie sieht es aus, wenn ich mit Gott rechne? Wenn ich auf Gottes Liebe vertraue und Jesu Verheißungen auf mich beziehe? Wie sieht mein Leben dann aus? Bleibt es bei meinen menschlichen Möglichkeiten, oder kann ich meine Beschränktheit und meinen Unglauben beiseitelassen, und kann ich mit Gottes Möglichkeiten für mein Leben, mein Sterben und meine Auferstehung rechnen.
Zum Abschluss schlage ich euch noch ein Gedankenexperiment vor. Stellt euch die Gesichter der Menschen damals vor, bevor ihnen bewusst wurde, dass alles, was Jesus gesagt hatte, Wirklichkeit geworden war. Der zusammengepresste Mund, die Sorgenfalten auf der Stirn, die zusammengekniffenen Auge – plötzlich die Erkenntnis! Es ist alles wahr! Auf einmal beginnt sich das ganze Gesicht zu entspannen. Die Mundwinkel gehen nach oben, aus den Sorgenfalten werden Lachfalten und die Augen öffnen sich (im wahrsten Sinne des Wortes). Und nun ersetzt das Gesicht der Frauen und Jünger durch euer eigenes. Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen
